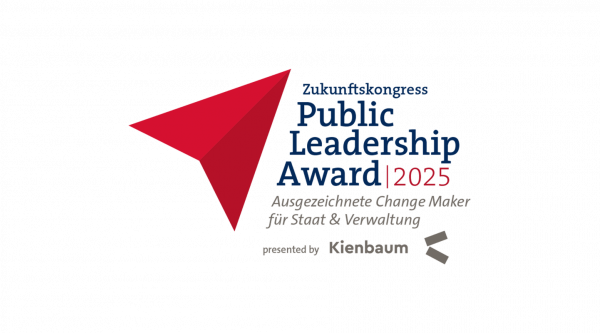Dieser Artikel folgt einer fiktiven Beraterwoche in einer Verwaltung im Umbruch. Er erzählt davon, wie Führungskräfte an gute Pläne glauben – und wie Mitarbeitende innerlich noch auf der Suche nach dem Einstieg sind. Und er erklärt, warum Transformation ohne psychologisches Verstehen scheitert. Denn digitale Systeme können noch so durchdacht sein – wenn das Gehirn nicht mitgenommen wird, wird die Veränderung nie ganz ankommen.
📆 Montag – Wenn das Big Picture nicht ins Großhirn passt
"Wir haben uns das wirklich gründlich überlegt." Die Amtsleiterin spricht diesen Satz mit einem Tonfall, der zugleich beruhigen und beeindrucken soll. Der Tisch ist groß, der Bildschirm geteilt, und in der PowerPoint-Präsentation liegt eine schlüssige Zukunft: neues Fachverfahren, verschlankte Abläufe, digitale Antragsstrecken, zwei Pilotphasen, ein Evaluationsmodul. Alles da.
Nur leider nicht im Kopf der Mitarbeitenden.
"Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum so viele erstmal abwarten", sagt sie. "Wir haben das im Führungskreis wirklich sorgfältig vorbereitet. Szenarien durchdacht. Stolperstellen antizipiert. Sogar die möglichen Einwände haben wir mal hypothetisch aufgelistet." Ich nicke, während ich den Satz still ergänze: Und genau deswegen wirkt es auf das Team jetzt so, als sei schon alles entschieden.
Was in Führungskreisen oft schon über Wochen verhandelt, bewertet und geplant wurde, ist für die Mitarbeitenden häufig der erste Kontakt mit dem Thema. Und während bei den Führungskräften bereits ein kohärentes Bild entstehen konnte und diskutiert wurde, beginnt bei den anderen gerade erst der emotionale Abgleich: Was bedeutet das für mich? Was fällt weg? Werde ich noch gebraucht?

Prof. Dr. Stephan Buchhester auf dem 11. Zukunftskongress Staat & Verwaltung
"Erfolgsindikatoren und Leistungskennzahlen der zukunftsfähigen Führung"
🗓️ 23. Juni, 11:00 - 12:00 Uhr
➡️ Hier geht's zur Werkstatt
Unser Gehirn denkt in Bildern. Als kleine Kinder lernen wir, dass all die Dinge, die wir anfassen können, auch Begriffe haben. Ball, Roller, Teller und so weiter. Irgendwann wird das Bild Gedächtnis durch ein Wort Gedächtnis weitgehend verdrängt. Das ist auf der einen Seite gut, weil wir plötzlich auch Begriffe können, für die es keine Bilder gibt wie z.B. Nachhaltigkeit, Vertrauen, Transparenz, Luft oder Liebe. Und solange wir uns in einer sicheren Umwelt bewegen, so lange wenig Stress da ist und wir gut vorher sehen können, wie sich unsere nächsten Tage und Wochen gestalten, haben wir auf dieses Wortgedächtnis auch einen guten Zugriff. Aber was passiert, wenn durch die Ankündigung plötzlich Stress entsteht?
Dann fehlen uns buchstäblich die Worte. Und wenn uns die Worte fehlen und unser Gegenüber aber noch keinerlei Bilder vermittelt hat – entsteht Stress. Das Gehirn der Mitarbeitenden signalisiert: Unbekannt = unsicher. Und Unsicherheit schlägt Neugier fast immer. Das ist kein Widerstand – das ist Neurobiologie.
Was in Führungskreisen oft schon über Wochen verhandelt, bewertet und geplant wurde, ist für die Mitarbeitenden häufig der erste Kontakt mit dem Thema.
📆 Dienstag – Wenn der Nucleus accumbens sich langweilt
"Ich weiß, wie’s geht. Aber ich fühl mich total unsicher damit." Die Stimme gehört einer Kollegin aus der Abteilung Digitalisierung. Sie hat soeben an einer Schulung zum neuen Fachverfahren teilgenommen. Fünf Module in zwei Wochen. Alles formal durchlaufen. Alle Häkchen gesetzt. Aber ihr Blick sagt: kein Haken dran.
"Ich mein’ – ich kann damit arbeiten. Aber irgendwie fühlt es sich immer noch nach einem Versuch und Irrtum an – und Irrtum gewinnt." Tic-Tac-Toe für Fortgeschrittene mit einer hohen Misserfolgsgarantie.
Was hier geschieht, ist kein Mangel an Wissen – sondern ein Mangel an psychologischer Rückmeldung. Unser Gehirn – insbesondere der Nucleus accumbens, das dopaminbasierte Belohnungszentrum – braucht das Gefühl, dass Handlungen Wirkung erzeugen. Früher war das einfach: Ich reiche einen Antrag ein, bekomme eine Reaktion. Ich sehe eine Akte, spüre Papier, höre ein Telefon. Realität war Rückmeldung.
Die digitale Welt ist da anders. Sie ist präzise, effizient, strukturiert – aber oft auch: entkoppelt. Ich klicke etwas an, aber niemand reagiert. Ich speichere – aber nichts bewegt sich. Ich erledige etwas, aber ich spüre keine Resonanz. Das System meldet: erledigt. Mein Gehirn meldet: unbefriedigt.
Das ist kein Mangel an Professionalität – sondern ein neurologisches Vakuum. Und wenn der Nucleus Accumbens zu oft leerläuft, verliert der Mensch Interesse. Erst emotional. Dann praktisch.
📆 Mittwoch – Wenn die Wirklichkeit nicht mehr greifbar ist
Es ist 09:00 Uhr. Teams-Meeting. Die Kameras sind aus. Die Stimmen sachlich. Das Thema: "Digitale Optimierung interner Prozesse". Auf dem Bildschirm: ein Flussdiagramm. In den Köpfen: Nebel.
Ich sehe nur Kästchen. Und Höflichkeit.
Was hier fehlt, ist nicht nur die Mimik. Es fehlt die Resonanz. Babys verbringen Monate damit, eine zweidimensionale Netzhaut-Welt in eine dreidimensionale Erfahrungswelt zu übersetzen. Sie tasten, schmecken, stolpern. Sie begreifen – im Wortsinn.
Und jetzt? Jetzt sitzen Erwachsene vor Kästchen. In einer Welt ohne Tiefe. Die Zunge ist nicht beteiligt, der Körper hat Pause. Und der Geist fragt sich: Ist das echt?
Transformation braucht erfahrbare Welt. Wenn sie nur in Schaubildern vorkommt, glaubt uns das Gehirn irgendwann nicht mehr, dass etwas real ist. Und dann wird aus gut gemeinter Kommunikation ein leeres Interface.
📆 Donnerstag – Wenn Zielbilder Angst machen
Ein Abteilungsleiter steht vor dem Team und präsentiert mit sichtlichem Stolz: Vision 2030. Digitale Antragsstrecken, virtuelle Besprechungsräume, hybride Aktenwege. Alles durchdacht, alles ambitioniert. Aber was beim Team ankommt, ist weniger Inspiration als Irritation.
"Das klingt gut", sagt eine Kollegin später im Flur, "aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen."
Und genau das ist der Punkt. Was das Gehirn nicht sehen kann, kann es schwer bewerten. Und was es nicht bewerten kann, macht es vorsichtig. Der Ist-Zustand mag nicht perfekt sein – aber er ist bekannt. Und Bekanntes erzeugt psychologische Sicherheit.
Ein vages Zielbild hingegen wirkt oft wie ein Nebel. Ohne Umrisse, ohne Anker. Und je weniger greifbar die Zukunft erscheint, desto stärker klammern sich Menschen an das, was sie kennen. Nicht aus Faulheit – sondern aus Selbstschutz.
Was das Gehirn nicht sehen kann, kann es schwer bewerten.
📆 Freitag – Wenn Führung zum psychologischen Brückenbau wird
"Was brauchen wir jetzt?" Die Frage kommt von einer Dezernatsleiterin, am Ende einer intensiven Woche. Sie meint nicht Tools, nicht Zeitpläne, nicht Roadmaps. Sie meint: psychologisch.
Meine Antwort beginnt mit einem Bild. Führung ist wie ein Dolmetscher zwischen zwei Welten. Zwischen dem, was gedacht wurde – und dem, was gespürt wird. Zwischen dem Zielbild und der Alltagssorge. Zwischen digitalem Tempo und analogem Verstehen.
Was es jetzt braucht, ist ein Perspektivwechsel – und ein Sensorik-Upgrade:
- Mehr Sinne für den Wandel. Räume, in denen etwas angefasst, gehört, ausprobiert werden kann. Transformation muss wieder durch die Hände gehen dürfen.
- Kleinteilige Entscheidungsspielräume. Mitarbeitende brauchen die Chance, mitzugestalten – nicht abstrakt, sondern konkret: "Worauf will ich Einfluss haben?" "Was kann ich selbst entscheiden?"
- Simulierte Sicherheit. Das Gehirn muss Signale bekommen: Du wirst gebraucht. Du darfst dich entwickeln. Und du bist nicht allein. Diese Signale entstehen nicht aus Präsentationen – sondern aus Begegnung, Feedback, Transparenz.
- Führung muss lernen, in Grund-Folge-Beziehungen zu sprechen, damit Bilder in den Köpfen entstehen können.
Führung muss nicht alles wissen. Aber sie muss alles ernst nehmen, was Menschen innerlich bewegt. Transformation ist kein Kommunikationsproblem. Es ist ein Resonanzproblem.
Und Resonanz entsteht nicht durch Geschwindigkeit – sondern durch Beziehung.