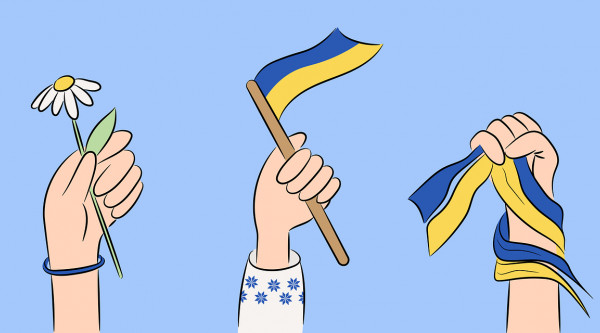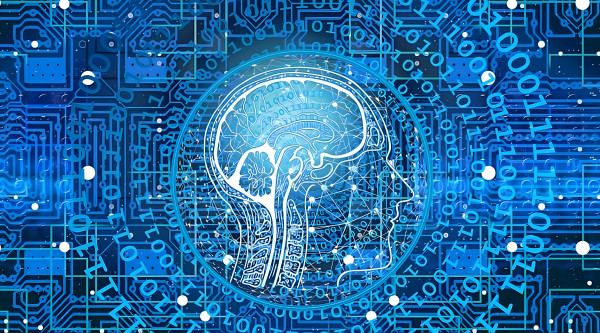Schließt endlich die Bürgerbüros!
Warum echte Verwaltungsdigitalisierung mehr als je zuvor notwendig ist
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat 23 Bürgerbüros, davon zurzeit drei geschlossen, für ca. 613.000 Einwohner. Die Bundeshauptstadt Wien, zugleich Bundesland, hat für mittlerweile knapp über 2 Millionen Einwohner nur 19 sogenannte Magistratische Bezirksämter, auch Amtshäuser genannt. Die BW-Bank hat in den letzten Jahren circa die Hälfte ihrer Filialen geschlossen. Andere Banken haben ebenfalls in den letzten Jahren ihre Filialnetze erheblich reduziert und Personal wie Filialen abgebaut und tun dies weiter – ohne Einschränkung der Servicequalität, sogar im Gegenteil mit besserem Service.
Der Grund hierfür ist ein einfacher: Wenn die Kunden ihre Dinge digital selbst erledigen können, werden physische Lokale, Öffnungszeiten bzw. Amtsstunden ebenso wie Heerscharen von Personal entbehrlich. Diese Lektion mussten in den letzten Digitalisierungsdekaden nicht nur Banken, sondern auch die Reisebüros oder die Buchhandlungen lernen.
Wer es offenbar noch nicht gelernt hat, aber dringend lernen muss, ist die öffentliche Verwaltung. Da die öffentliche Verwaltung (scheinbar!) ohne Konkurrenz auf ihrem Staatsgebiet ist, konnte sie sich dem Rationalisierungsdruck der Wirtschaft entziehen. „Scheinbar“ deshalb, da natürlich ein internationaler wie innereuropäischer Standortwettbewerb in Bezug auf Investitionen und Talente herrscht und dabei die Digitalisierung ein wesentlicher Standortfaktor geworden ist.
Sehr dunkle Wolken am Horizont
Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich nach dem Wiederaufbau und dem Wirtschaftswunder, der Wiedervereinigung und einer langen Periode des Friedens und des Wohlstands nun einigen, seit langem ungewohnten Einflüssen ausgesetzt:
- Stark sinkende Steuereinnahmen wegen Rezession:
Die Steuerschätzer erwarteten bereits vor den letzten Aktionen der USA sinkende Steuereinnahmen in den kommenden Jahren. - Politisch volatile Führung:
Es bilden sich vermehrt Koalitionen, die nur noch deshalb existieren, weil anders keine Mehrheit mehr erreichbar ist. Bei der jüngsten Bundestagswahl erreichte die stärkste Partei, eigentlich waren es zwei Parteien, nicht einmal mehr 30 % der gültigen Stimmen, eine weitergehende Zersplitterung der Parlamente bis hin zur völligen Unmöglichkeit von Zweiparteienregierungen ist abzusehen. - Riesiger Aufrüstungs- und Infrastrukturinvestitionsbedarf infolge der politischen Verhältnisse in Kiew, Moskau und Washington einerseits sowie infolge der verrotteten Infrastruktur andererseits.
- Massive Versäumnisse bei der Digitalisierung in den letzten Dekaden, v. a. in der Verwaltungsdigitalisierung, dazu strategische Fehlentscheidungen in Form nationaler Sonderwege statt konsequenter Umsetzung europäischer Standards, wie z. B. die De-Mail.
- Eine stark gestiegene Inflation, die erwartungsgemäß zu hohen Lohnrunden auch im öffentlichen Dienst führt. So jüngst der Abschluss für Bund und Kommunen mit 5,8 %, der wohl wiederum die Lohn-Preisspirale weiterdrehen wird.
- Erwartbar steigende Zinsen für die Schulden der öffentlichen Hand, insbesondere auch für die neuen Schulden, wenngleich diese „Sondervermögen“ genannt werden.
- Einem Arbeitsmarkt, auf dem Fachkräfte fehlen – trotz zumindest nominell massiver Zuwanderung in der letzten Dekade.
Ein massiver Personalabbau im öffentlichen Dienst erscheint alternativenlos.
Nicht Digitalisierung im Bürgerbüro, sondern Digitalisierung anstatt ins Bürgerbüro
Der Autor ist Nutzer der App "Digitales Amt" der Republik Österreich und im Besitz der gratis zur Verfügung gestellten, eIDAS-konformen ID Austria sowie der damit einhergehenden digitalen Signatur, die ebenfalls gratis ist. Wenn aus irgendeinem Grund eine Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde erforderlich ist, so kann die entweder mit dem PC oder gleich mit der App "Digitales Amt" binnen zweier Minuten beantragt, ausgestellt und gratis bezogen werden. Diese Urkunde ist eine PDF-Datei mit einer gültigen digitalen Signatur der ausstellenden Behörde und kann somit verwendet werden wie das Papieroriginal.
Wenn das in München geborene Kind des Autors hingegen eine Geburtsurkundenabschrift braucht, dann muss diese beim Kreisverwaltungsreferat München persönlich oder online bestellt werden, wird auf Papier gedruckt, händisch unterschrieben und gestempelt und dann per Post innerhalb von behauptet zwei Wochen zugestellt. Dafür bezahlt man 12 Euro Gebühr. Die Möglichkeit, die Papierurkunde online zu beantragen – prinzipiell auch durch fremde, ahnungslose Personen, da eine verlässliche Identifikation entweder nicht erforderlich ist oder schlicht nicht verlangt wird – wird von den Verantwortlichen dann als „Smart City München“ verkauft.
Die öffentlich Bediensteten, die das im KVR München machen, sind bei zeitgemäßer Digitalisierung entbehrlich. Denn digitale Geburtsurkunden hat sogar die Ukraine, arm und im Krieg befindlich, auch diese ist Deutschland mit ihrer „Dija-App“ auf dem Gebiet des e-Government um Dekaden voraus.
Warum ging es bislang nicht?
Um – wie in vielen europäischen Staaten – eine so einfache Funktion wie eine kostenlos beglaubigte Geburtsurkunde per Knopfdruck bereitzustellen, braucht es nur wenige Voraussetzungen, die bislang jedoch nicht geschaffen wurden.
- Verbreitete elektronische Identifikation und Authentifikation – hier ist die eID des einstmals „neuen Personalausweises“, der mittlerweile auch bereits über 14 Jahre alt ist, gefragt. Sie ist, verglichen mit anderen in der EU verbreiteten eIDs umständlich in der Handhabung, wie jeder Onlinebanking-Kunde bestätigen kann. Außerdem beinhaltet sie massive Konstruktionsfehler, wie z. B. das Fehlen der Möglichkeit der Stellvertretung für Kinder oder juristische Personen als deren Organ.
- Zentrales Melde- und Personenstandsregister – das scheiterte bislang am Beharrungsvermögen der Länder und Kommunen, weshalb mit über 5.300 dezentralen Melderegistern zu arbeiten versucht wird. Auch eine Nachdigitalisierung der Personenstandsurkunden, wie in Österreich vor 2014 erfolgt, wäre erforderlich.
- Zentrales Portal und zentrale e-Government-App: Auch Österreich ist hochgradig föderal organisiert und besteht aus neun Bundesländern – allerdings ist bisher noch kein Landeshauptmann auf die Idee gekommen, etwa ein eigenes Landesportal wie „service-tirol.at“ aufzusetzen und dieses parallel zu acht weiteren Landesportalen plus einem Bundesportal zu betreiben. Weder allein noch im „Portalverbund“.
- Digitale Signatur und Identität jeder Behörde: Deutsche Behörden haben kein Äquivalent zur österreichischen Amtssignatur und können deshalb auch keine PDF so signieren, dass die Authentizität überprüfbar sichergestellt ist – auch ein Äquivalent zu www.signaturprüfung.gv.at ist in Deutschland nicht vorhanden.
Zu glauben, dass bei weiterhin dezentralen Registern und potenziell etlichen tausend „zuständigen“ Behörden auch nach einer hypothetisch erfolgreichen Umsetzung von OZG und Registermodernisierung solche Funktionalitäten existieren werden, erscheint vermessen.
Was getan werden muss
Das ist mit zwei Sätzen zu beantworten:
- Stopp des „Weiter so“-Dahinwurstelns mit OZG und Registermodernisierung.
- Einberufung eines nationalen Konvents, der die Digitalstrategie auf breiter Basis festlegt und die notwendigen Änderungen der staatlichen Aufgabenverteilung ermöglicht. Dass es hier notwendig ist, alle Parteien und Interessensgruppen einzubinden, beweist die Zusammensetzung des Österreich-Konvents 2003-2005.
Ob das neue Bundesministerium für Digitalisierung den Mut aufbringt, die beiden Projekte OZG und Registermodernisierung so zu stoppen, wie einst Daimler-Vorstandsvorsitzender Zetsche die Fusion mit Chrysler wieder rückgängig machte, wird man sehen. Dass die Energie für einen überfälligen nationalen Konvent aufgebracht wird, ist noch unwahrscheinlich. Dazu müssten die Probleme wohl noch drückender werden, als sie schon sind.